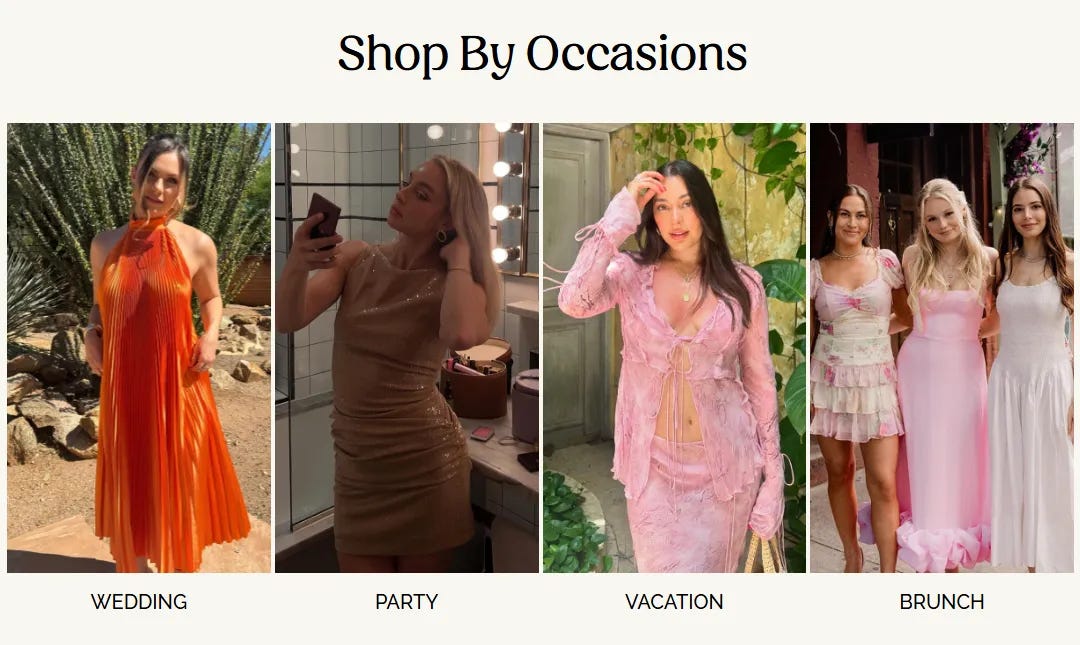Vollnarkose auf die eins
Geistige Umnachtung gibt's auf Rezept
Ich bin offenbar alte Bundesrepublik. Nachdem ich mich wieder angezogen habe und bevor ich den Wachraum Richtung Ausgang verlasse, hole ich noch zwei Scheine aus dem Portemonnaie, lege sie auf den Schrank mit den Pflege-Utensilien und stelle die leere Flasche „Staatl. Fachingen“ drauf.
Vollnarkose macht Durst, denke ich, und komme mir vor, wie die Oma, die dem jungen Mann vom Supermarkt fünfzig Pfenninge in die Hand drückt, weil der ihr die Einkäufe drei Straßen weit und sieben Stockwerke hoch geschleppt hat. Sehr alte Bundesrepublik.
So ein Besuch im OP muss keine große Sache sein. War er in meinem Fall auch nicht. Und doch legt einen so eine Erfahrung kurz mal still.
Erst einmal im wahrsten Sinne. Wenn der Anästhesist nämlich sagt zu dir: „Die Schwester spritzt ihnen jetzt das gute Zeug“, er dich bittet, bis zwanzig zu zählen, und du dir schon den Kalauer zurechtgelegt hast, nach der neunzehn „Neunzehneinhalb!“ zu sagen. Aber offenbar hat das gute Zeug eine Unverträglichkeit gegen die zotige Bewältigungsstrategie, mit der du ein Leben lang deine Ängste niedergerungen hast. Stattdessen wachst du einen Wimpernschlag später auf und alles ist längst vorbei.
Noch eindringlicher ist nur die Demut, die das Angewiesensein lehrt. Die Schwester, die mir das knappe Leibchen hinten zuschnürt. Die Frau, die meine Verkabelung vorm Vertüddeln bewahrt, als ich mich ungelenk auf den Tisch hieve, während mir sechs Augenpaare zwischen Masken und Hauben hindurch dabei zusehen. Nicht zu vergessen, der Chirurg, der in mir fuhrwerken darf.
Zwischen angewiesen und ausgeliefert ist’s ein schmaler Grat. Selbst nichts zu können, stattdessen ganz von anderen abzuhängen, kappt kurz die Selbstwirksamkeit, auf die wir so scharf sind. Im normalen Leben machte mich solche Ohnmacht ungehalten. Jetzt ging’s nicht anders, und doch ging’s gut.
Das Trinkgeld war gut investiert in eine neue Jahreslosung: Wird schon. Muss ja.
Was mit Bewegtbild
Ich hatte das angedeutet. In Sachen Popkultur gefalle ich mir gerade sehr in der Rolle des contrarian. Ich verschweige einfach, dass mich dieser Tage „The Last of Us“ so adrenalingeil macht wie alle anderen, und überbetone, dass es auf meinen Bildschirmen nicht unterkomplex (vulgo: untrendig) genug zugehen darf.
Wahrscheinlich liegt’s daran, dass das Weltgeschehen und meine Watchlist ein emotional instabiles Gemisch gebildet haben. Kurz hatte ich sogar erwogen, mein Gespartes in einen Bunker auf dem Balkon zu stecken. „The Last of Us“ also, dann noch „Paradise“, „Fallout“ und in Buchform: „New York Ghost“ – in meinem Ausschnitt von der Geschichten-Welt geht’s gerade nur apokalyptisch zu. Das hält doch keine Seele lange aus!
Gottlob bieten die Mediatheken von ARD und ZDF reichlich Gelegenheiten zur Überkorrektur. Bei nichts kommt man so gut runter, wie bei einer Folge Rosenheim-Cops. Ab Minute eins ist klar, dass der Sepp sterben musste, weil er sich geweigert hat, diese eine Wiese an den gierigen Bauunternehmer Hubermaierhofer abzutreten. Für alle, die zu faul sind zum Selberdenken, schlendern die Ermittler durch Postkarten-Landschaft und käuen die Fakten noch mal wieder.
Steile These: Jeder Tatort funktioniert genauso, bildet sich nur mehr ein.
Ohne Gesichtsverlust komme ich hier nur noch raus, indem ich das alles als ironischen Selbstversuch deklariere. War’s aber nicht, und deshalb kommt’s hierauf auch nicht mehr an: „Praxis mit Meerblick“, die Serie um die rüde Rügen-Ärztin Nora Kaminski, würde ich tatsächlich wieder schauen – auch wenn mein Körper gerade kein Anästhetikum abbaut.
Was mit Takten
Wo wir uns gerade so nett einschmieren mit gebührenfinanzierten Landschaftsaufnahmen: „Iris“ von den Goo Goo Dolls lief auf meiner Mediatheken-Expedition zu irgendeiner Schlussszene. Ich weiß nicht mehr in welcher. Ist aber auch egal. Der Song passt eigentlich zu jeder Schlussszene jeder Folge jeder Mediatheken-Serie. Also kommen hier vier Minuten neunundvierzig musikalisches Vanilleeis für alle die, die gerade keine Zeit haben für eine ganze Folge Heileweltfernsehen.
Was mit Buchstaben
Ist ja gut! Wenn jeder so viel Indolenz an den Tag legte wie ich, wär niemand mehr da, mit dem noch Staat zu machen ist. Versuchen wir also noch einen kurzen Blick auf die tatsächliche Wirklichkeit. Lesen sie dafür bloß nicht das weinerliche „Die Privilegierten“ von Thomas von Steinaecker! Das hab ich schon 624 lauwarme Seiten lang gemacht. Greifen sie vielleicht zu Ijoma Mangolds „Der innere Stammtisch“. Als Nestor des deutschen contrarian-Seins kartäscht der quer durch alle politischen Lager gegen das Nichtwissen, den Konformismus und die Heuchelei. Macht Spaß, tut gut.
Mangolds prätentiöser Ausdruck kratzt ein bisschen an der Grenze zum Affektierten, ohne aber rüberzustelzen. Nach der Lektüre könnten sie jedoch versehentlich Ausdrücke wie „vulgo“, „Indolenz“ oder „Nestor“ gebrauchen. Aber das ist nichts, was drei Folgen „Praxis mit Meerblick“ nicht wieder einrenken.
Was mit Internet
Schwarzseherei ist meine Sache also nicht. Wird schon. Muss ja. Eine Idee, die eindeutig kacke ist, muss aber weiter Kackidee heißen. Neulich las ich von Pickle, einer App, die für sich in Anspruch nimmt, das Airbnb für Klamotten zu sein.
Lassen wir den Hauch von Ekel mal außer Acht, den man sonst nur fühlt, wenn einem der 15-Jährige mit den fettigen Haaren die Bowlingschuhe über den Tresen reicht. Aber ich kann doch unmöglich der einzige sein, dem spontan drei dutzend kranke Wege einfallen, wozu der durchschnittliche Internet-Ork eine App benutzen wird, in der Creator-schöne Menschen und ihre KI-Klone getragene Wäsche feilbieten. Und kein Weg hat mit Klamotten-Miete zu tun.
Was mit Auslöser